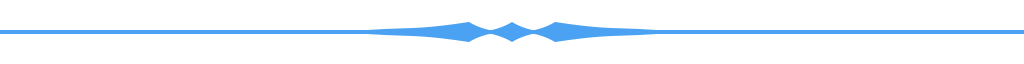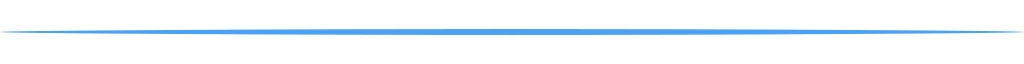Rechtschreibung, Werkzeuge und gefährliche Wörter

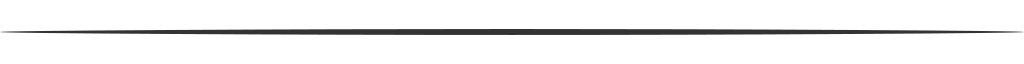
Rechtschreibung
Die deutsche Rechtschreibung leidet noch immer unter dem Nackenschlag, den ihr die Rechtschreibreform der 90er Jahre versetzt hat. Seither schwingt bei jedem geschriebenen Satz die Hoffnung mit, die eben verfassten Wörter könnten ja zufällig nach irgendeiner Reformregel korrekt sein.
Eine einwandfreie Rechtschreibung bedeutet jedoch mehr, als das bloße Befolgen stupider Regeln. Je nach Schwere der vorhandenen Fehler sinkt das Ansehen, welches vom Text auf den Autor abfärbt. Lass mich das in zwei kurzen Beispielsätzen demonstrieren:
"Zur Zeit überhäuft ein wohlgesonnener Freund, der den Sommerurlaub diesen Jahres in einer ländlichen Idylle verbringt, mein Postfach mit Emails."
Fünf Fehler stehen da in einem Satz. Mir rollen sich zwar die Fußnägel hoch, aber diese Art der Fehler mag ich noch verzeihen. Selbst mein Rechtschreibprogramm erkennt gerade einmal zwei Fehler davon. Im Gegensatz dazu höre ich jedoch sofort mit dem Lesen auf, wenn ich auf Sätze stoße wie:
"Füsik ist im wesentlichen die Wissenschaft der Natur und weltlichen Gesetzmässigkeiten."
Das sind zwar nur drei Fehler, aber deutlich sichtbarere. Schon wenige Rechtschreibfehler am Anfang eines Textes zerstören komplett das Vertrauen in die Kompetenz des Autors. Fehlerkorrekturprogramme und Duden sind daher meine ständigen Begleiter, sozusagen die Schutzengel meines beruflichen Lebens. Wichtige Texte gebe ich zum Korrekturlesen auch gerne in vertrauenswürdige Hände oder an professionelle Lektoren ab.
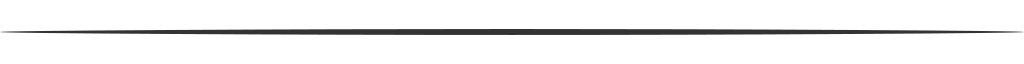
Gefährliche Wörter
Wer klug ist, liest an dieser Stelle nicht weiter.
Da Du weiter liest, heiße ich Dich hiermit herzlich willkommen im Klub der Idioten. Wie Du und ich tun sich die meisten Menschen schwer damit, das Wort "nicht" wahrzunehmen, ihm die nötige Wichtigkeit beizumessen oder gebührende Konsequenzen aus dessen Einsatz zu ziehen.
Sagst Du einem Kleinkind "Tritt nicht in den Hundehaufen", holst Du besser schon einmal die Taschentücher zum Putzen der Schuhe heraus. Der Ausruf "Vorsicht, tritt neben den Hundehaufen", wirkt deutlich besser und erklärt dem Kind, wie es sich verhalten soll. Gleiches gilt beim Schreiben. Ich versuche daher alle negativen Formulierungen zu vermeiden, vor allem "nicht" und Adjektive, die mit "un" beginnen.
Vorsichtig gehe ich auch mit Worten wie "muss" oder "sollte" um. Viele Leser nehmen diese Aufforderung als Bevormundung wahr und sträuben sich innerlich gegen die Textaussage. Ich versuche lieber die Gedanken auf das Ergebnis zu lenken. Anstelle von "Du solltest Dein Auto waschen" schreibe ich, "Ein sauberes Auto erhältst Du durch gründliches Waschen".
Unpersönliche Wörter wie "man" oder Ausdrücke mit "kann" oder "werde" sind langweilig und schaffen Distanz. Mit aktiven Formulierungen involviere ich den Leser stärker und hebe den Text auf eine persönliche Ebene. Außerdem definiere ich genau, wer die Akteure meiner Handlung sind. So wird aus einem "Man wäscht sich nach dem Toilettengang die Hände" ein viel freundlicheres "hygienebewusste Menschen waschen sich nach dem Toilettengang ihre Hände". Ich überlasse dem Leser, ob er sich zu dieser Gruppe zählt.
Andere Wörter bereiten Probleme, weil Leser den Bezug nicht erkennen. Ein allein gestelltes "es" oder "das" ist mehrdeutig, eine fremdartige Abkürzung verwirrend. Lese ich "er kann das/es schaffen", dann beginne ich zu rätseln, was derjenige schaffen kann.
Das nächste sprachliche Minenfeld stellen Füllwörter dar, also Wörter wie "so", "etwa", "auch" oder "dann". Sie streiche ich wo immer möglich, damit mein Text knapp und prägnant bleibt.
Ich will hier kein Verbot der problematischen Wörter aussprechen, da sie einen wichtigen Platz in der deutschen Sprache einnehmen. Die oben genannten Wörter sind nur jene, bei denen ich grundsätzlich ein zweites Mal drauf schaue, ob sie wirklich angebracht oder doch vermeidbar sind.