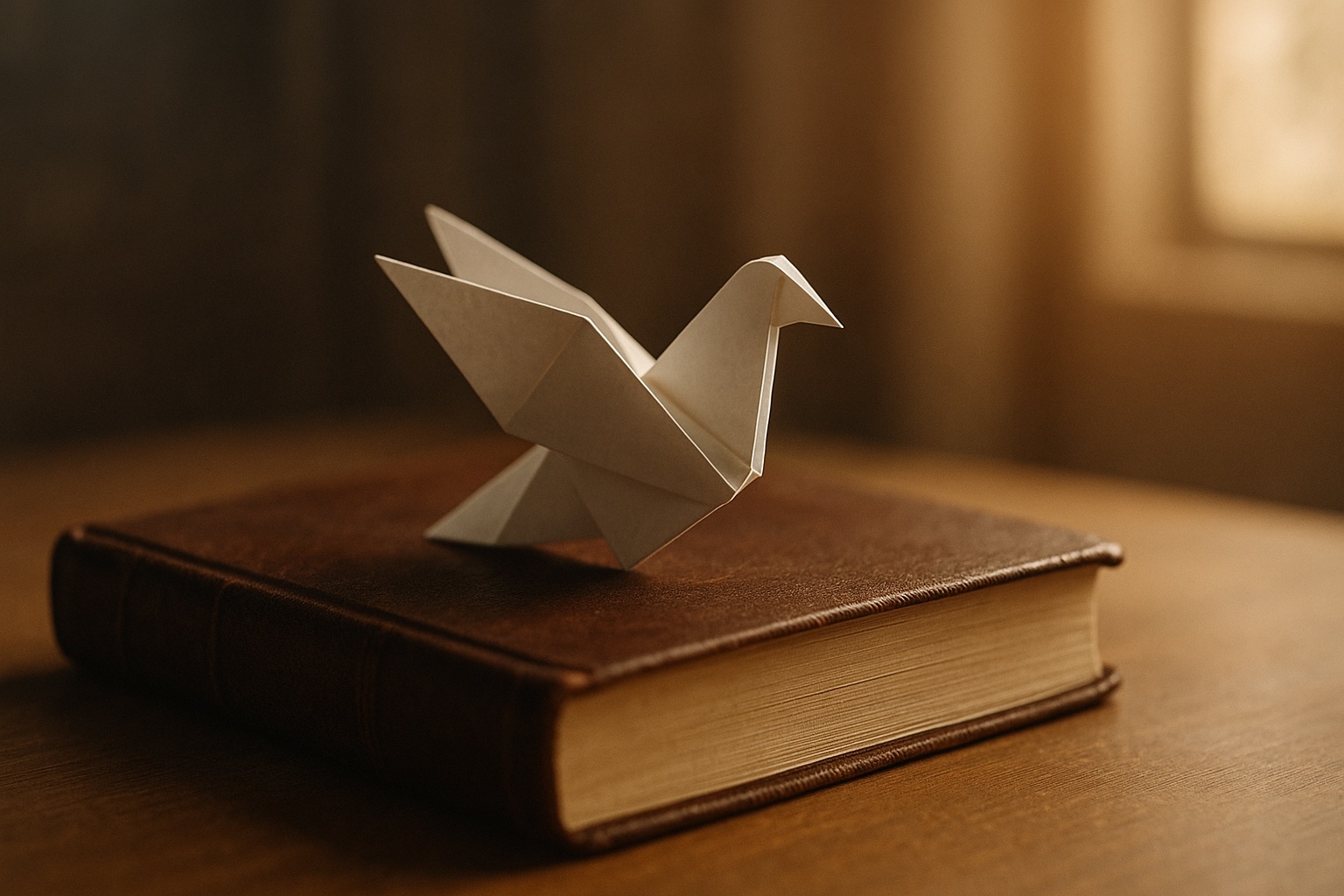 Dieses Essay richtet sich an jene, die sich weder in den Reihen der Gläubigen noch in den Lagern der Ideologen zu Hause fühlen.
Es ist ein Angebot zum Innehalten, ein stiller Raum für die eigene, unbeeinflusste Erkenntnissuche.
Möge der Leser nicht Antworten erwarten, sondern die Freiheit, die eigenen Fragen neu zu stellen.
Dieses Essay richtet sich an jene, die sich weder in den Reihen der Gläubigen noch in den Lagern der Ideologen zu Hause fühlen.
Es ist ein Angebot zum Innehalten, ein stiller Raum für die eigene, unbeeinflusste Erkenntnissuche.
Möge der Leser nicht Antworten erwarten, sondern die Freiheit, die eigenen Fragen neu zu stellen.
Prolog – Die stille Wiederkehr alter Fragen Manches verschwindet nicht wirklich, es wechselt nur seine Kleider. So ist es auch mit den großen Fragen, die uns als Menschheit seit Generationen begleiten. Man nennt sie anders, verpackt sie in neue Begriffe, doch unter dem frischen Anstrich verbirgt sich oft der alte Kern. Ich bin in einer Zeit aufgewachsen, in der der Begriff "Frieden" die Köpfe füllte und doch stets der kalte Hauch des drohenden Krieges durch die Gesellschaft wehte. "Der bedrohte Frieden" war mehr als nur ein Buchtitel – es war ein kollektives Lebensgefühl. Heute, viele Jahrzehnte später, frage ich mich: Sind diese Fragen jemals wirklich beantwortet worden? Oder haben wir sie nur vergessen, weil die Kulisse eine andere geworden ist?
Landesverteidigung – Eine stille Frage an das Eigentum Wenn von „Landesverteidigung“ die Rede ist, scheint alles klar: Da gibt es ein Land, eine Grenze, einen Raum – und diesen gilt es zu schützen. Doch wenn man einen Moment innehält und fragt: Was genau wird hier verteidigt – und wem gehört es eigentlich?, dann entfaltet sich eine tiefere, oft übersehene Dimension dieser Debatte.
Eigentum ist eine der ältesten Ordnungsgrößen menschlichen Zusammenlebens. Dort, wo der eigene Acker begann, stellte man einen Zaun auf; wo der eigene Herd brannte, war das Heim. Eigentum war immer das, was ein Mensch mit seinem Tun, seiner Fürsorge und seiner Verantwortung verband. Es war konkret, fassbar, und sein Wert war untrennbar mit der Person verknüpft, die es hegte.
Doch was ist mit dem Land, das ein Staat verteidigt? Wer ist dort eigentlich der Eigentümer? Die Bürger, die dort leben? Doch sie können ihr Stück Land oft nur behalten, solange sie Abgaben leisten. Die Flüsse, die Wälder, die Berge – kann ein Mensch sie wirklich sein Eigen nennen? Oder ist das Eigentum hier ein abstrakter Begriff geworden, verwoben mit Urkunden, Verordnungen und historischen Ereignissen, die wenige noch nachvollziehen können? Und weiter gefragt: Ist Macht selbst eine Art Eigentum? Kann jemand von sich sagen: „Diese Macht gehört mir, und ich verteidige sie gegen den Zugriff anderer“?
Wenn das so wäre, dann wäre die Landesverteidigung nicht die Verteidigung eines Landes, sondern die Verteidigung eines Machtanspruchs. Nicht der Apfelbaum im Garten wäre bedroht, sondern der Anspruch, über viele Apfelbäume – und deren Besitzer – zu bestimmen.
Vielleicht ist das die eigentliche, unausgesprochene Frage: Verteidigen wir Dinge, die in einer direkten, natürlichen Beziehung zu uns stehen – oder verteidigen wir Ansprüche, die längst zu abstrakten Besitzständen geworden sind, getragen von Institutionen, deren Eigentumstitel im Nebel der Geschichte liegen? Der Mensch hat seit jeher das natürliche Recht, das zu schützen, was er selbst geschaffen oder gepflegt hat. Aber gilt dasselbe auch für die Verteidigung von Macht? Und wenn ja – wer stellt dann den Eigentumstitel aus?
Vom Verteidigen und vom Gehen – Die stille Flucht vor der Verantwortung Es ist eine merkwürdige Zeit. Über Landesverteidigung wird erneut gesprochen, als wäre der Begriff nie alt geworden. Uniformen, Pflichtdienste, das Ziehen von Grenzen und das Erheben von Forderungen an jene, die die Last tragen sollen – die jungen Menschen. Doch während die politischen Rufe lauter werden, sind die Antworten derjenigen, die es betreffen wird, leise. „Man könnte doch auswandern“, heißt es dann oft. Eine beiläufige Floskel, fast ein modisches Bekenntnis zu einer grenzenlosen Welt, in der man Unannehmlichkeiten einfach hinter sich lässt.
Aber ist Weggehen wirklich eine Entscheidung – oder nur ein anderer Name für Ohnmacht? Man mag sein Hab und Gut packen können, den Pass und den Rest des Ersparten. Aber wohin geht der Mensch, der vor sich selbst davonläuft? Denn eines bleibt, gleich wo man sich niederlässt: Die Verantwortung für das eigene Leben, für das eigene Denken – und für das, was man zu schützen bereit ist.
Hier taucht eine alte, fast vergessene Frage auf: Wer seinen eigenen Leib, sein eigenes Ich nicht mehr verteidigen will – was wird er dann verteidigen? Nicht jede Verteidigung braucht Waffen. Aber jede beginnt mit einer Haltung. Jener stillen Überzeugung: „Ich bin der Eigentümer meines Lebens. Und ich entscheide, wofür ich stehe – und wofür nicht.“ Ohne diese innere Haltung wird auch der neue Ort nur eine Zwischenstation sein. Denn wer nicht weiß, was sein Eigentum wirklich ist, kann es weder verteidigen noch bewahren. Und wo immer man auch hingeht – der Preis für diese Unklarheit wird am Ende höher sein als jede Steuer, jede Pflicht und jedes Gesetz.
Die Unausgesprochenen – Über die Namenlosigkeit des Feindes Es wird viel gesprochen in diesen Tagen. Über Verteidigung, über Bereitschaft, über die Notwendigkeit, sich zu wappnen. Und doch fällt eines auf: Der Feind bleibt namenlos. Er wird nicht gezeigt, nicht benannt, nicht umrissen. Er schwebt wie ein Schatten durch die Reden – stets vage, stets formbar. Man müsse vorbereitet sein, heißt es, falls es eintritt. Falls jemand kommt. Falls etwas geschieht. Und während diese Unklarheit bestehen bleibt, ist das, was verteidigt werden soll, erstaunlich klar umrissen: „Unsere Werte. Unsere Freiheit. Unsere Demokratie. Unser Wohlstand. Unser Leben.“ Doch wer ist dieses „unser“?
Spricht es aus dem Munde derer, die jeden Tag darum kämpfen, ihr Leben in Würde zu führen? Oder aus jenen, die von dieser Ordnung profitieren, ohne je ihre Konsequenzen zu tragen? Unser – das klingt nach Gemeinschaft, nach Verbundenheit. Aber ist dieses „unser“ noch ein ehrlicher Begriff, wenn der Preis für diese Verteidigung nicht von denen getragen wird, die diese Worte so leicht über die Lippen bringen?
Wer den Feind nicht benennt, lässt den Kampf offen – und vielleicht ist genau das beabsichtigt. Denn ein namenloser Feind kann überall sein. Und so bleibt auch das, was verteidigt werden soll, am Ende oft genauso namenlos: Nicht das eigene Heim, nicht die eigene Freiheit im echten, lebendigen Sinne – sondern ein abstraktes Konstrukt von Macht, Besitz und Einfluss, das sich hinter dem schlichten Wort „unser“ verbirgt.
Die wahre Grenze – Wo Gefahr wirklich beginnt Es ist bequem, den Feind im „Anderen“ zu suchen. In einer anderen Sprache, in einer fremden Religion, einer ungewohnten Lebensweise. Doch die wahre Gefahr trägt keinen Pass und keine Hautfarbe. Sie zeigt sich im Moment des Übergriffs – und das unabhängig von Nationalität, Tradition oder politischer Gesinnung. Die Grenze verläuft nicht zwischen Ländern, sie verläuft zwischen den Haltungen der Menschen: • Zwischen denen, die das Eigentum des Anderen achten – und denen, die es missachten. • Zwischen denen, die Freiheit gewähren – und jenen, die sie nehmen. • Zwischen jenen, die ein geliehenes Gut als heilig betrachten – und jenen, die es missbrauchen, als wäre es ihr Recht. Der Übergriff beginnt nicht erst mit der erhobenen Waffe. Er beginnt viel leiser: • Mit dem ersten herabwürdigenden Wort. • Mit der stillen Duldung von Gewalt im eigenen Umfeld. • Mit dem Griff nach dem, was einem nicht gehört – sei es ein Besitzstück oder die Würde eines anderen Menschen. Und so wird klar: Nicht der „Russe“, nicht der „Islam“, nicht der „Andere“ ist die Gefahr. Die Gefahr ist der Übergriff selbst – wo auch immer er sich zeigt. Wer das erkennt, braucht keine Feindbilder. Er lebt nach dem einfachen, aber universellen Prinzip: „Glaube, was du willst. Aber wirf deine Steine nicht nach mir – denn ich werde sie dir zurückwerfen.“ Das ist kein Pazifismus, kein bellizistischer Aufruf. Das ist die klare Haltung eines Menschen, der seine Grenzen kennt – und der auch bereit ist, sie zu verteidigen. Nicht, weil er den Kampf sucht. Sondern weil er den Frieden achtet.
Epilog – Die unbeantworteten Fragen des Friedens Ich bin in einer Zeit aufgewachsen, in der das Wort „Frieden“ in aller Munde war – und doch lag in diesem Frieden stets der kalte Hauch des drohenden Krieges. Die Bücher jener Zeit trugen Titel wie „Der bedrohte Frieden“, und während man scheinbar nach Wegen zum Frieden suchte, ging es oft mehr um Interessen als um echte Versöhnung. Man sprach von Blöcken, von Abschreckung, von Gleichgewicht – doch war der Kalte Krieg wirklich beendet, als der Warschauer Pakt aufhörte zu existieren? Oder wurde nur ein neues Kapitel aufgeschlagen, dessen Überschrift wir bis heute nicht zu lesen vermögen?
Die Vereinigten Staaten, einst die selbsternannte Weltpolizei, ziehen sich scheinbar zurück. Doch ist es wirklich ein Rückzug – oder nur ein Strategiewechsel? Die Botschaft klingt klar: „Kauft unsere Waffen – wir helfen euch nicht mehr.“ Doch war es je wirkliche Hilfe? Oder war es stets ein Geschäft – verpackt in den Mantel der Freiheit, verziert mit den Symbolen der Demokratie, doch letztlich geleitet von den gleichen alten Interessen? Und während wir glauben, die alten Feindbilder wären längst verblasst, stellt sich die stille Frage: Wer ist wirklich aus Europa verschwunden? Und wer ist – vielleicht nur in anderer Gestalt – immer noch da?
Vielleicht ist der Kalte Krieg nie wirklich zu Ende gegangen. Vielleicht hat er nur seine Uniform gewechselt, den Tonfall angepasst und die Fragen neu formuliert, ohne jemals echte Antworten zu geben. Und so bleibt das, was heute geschieht, für den aufmerksamen Beobachter weniger ein Wandel, als vielmehr die Fortsetzung jener alten Spiele – nur auf einem neu gedeckten Tisch.
