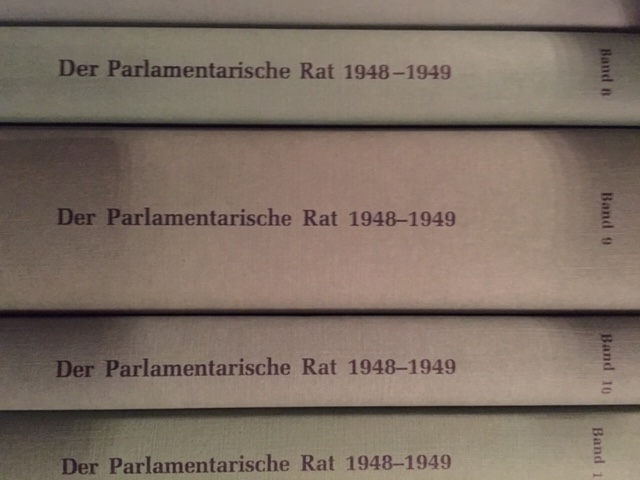
Zu Teil 1 und 2 der Serie „Mein Fall! Abenteuer Recht und Justiz“ in #mein-fall muss sich der Leser nachfolgende Erkenntnisse, die wir bereits 1999 erarbeitet haben, vor Augen führen.
Für mich ist es schwer nachzuvollziehen, warum die Bürger sich so vehement dagegen sträuben, sich mit Recht auseinandersetzen. Tagtäglich sind sie in einen Wirtschafts- und Handelskreis eingebunden, ohne diesen sie nicht überleben könnten. Aber Interaktionen mit anderen Menschen sind unmittelbar mit Rechten verknüpft. Wirtschaftliche Interaktionen angefangen beim einfachen Tausch, bis hin zu komplexen Wirtschaftsaktivitäten sind ohne „das Recht“ überhaupt nicht denkbar. Interagierende Individuen müssen doch ihre Rechte und die daraus entstehenden Pflichten kennen. Diese Forderung ist zumindest für erwachsene Menschen, die sich als „mündig“ verstehen und als solche angesehen werden wollen, eine Grundpflicht. Wenn dies nicht der Fall ist, wird jede Unterschrift, die diese scheinbar mündigen Menschen leisten, zu einem „Blankoscheck“ und zu einem Abenteuer. Und scheinbar sind der Großteil der Bürger, zumindest in der Bundesrepublik Deutschland, nicht mündig und dürften am Wirtschaftsleben überhaupt nicht ohne Vormund teilnehmen.
Aber wie gesagt, das ist lediglich nur für mich nicht nachvollziehbar.
Aber jetzt weiter zur:
Manipulation
Die Existenz des Grundgesetzes allein bietet keinerlei Gewähr dafür, dass die Bundesrepublik Deutschland den Status als Demokratie und Rechtsstaat zu Recht für sich in Anspruch nehmen kann. Vielmehr ist bereits der Fakt gegeben, dass das Grundgesetz selber nicht mehr mit dem Anspruch zu vereinbaren ist, dem es genügen soll: eine freiheitlich demokratische Grundordnung für alle Bürger im Rechtsraum der Bundesrepublik Deutschland zu sein.
Die vollzogenen Manipulationen des Grundgesetzes sind nachfolgend aufgezeigt: Sie sind für den einzelnen Bürger eigentlich überhaupt nicht erkennbar. Genau die Art und Weise, wie einzelne Bestimmungen des Grundgesetzes in ihrer Wirkung ausgehöhlt wurden, ohne dass sie textlich verändert werden mussten, zeugt von einer unerhört hohen kriminellen Energie, die hier seitens des von den Parteien beherrschten Gesetzgebers zum Einsatz gekommen sein muss. Anmerkung: Das Grundgesetz ist zur Gänze unter www.bundesregierung.de einsehbar. Ich empfehle jedoch, die Urfassung vom 23. Mai 1949 heranzuziehen, um auch die rechtswidrige Metamorphose des GG nachvollziehen zu können, wie wir in den nächsten Teilen in #mein-fall noch ganz genau sehen werden (Dieser heutige Teil 3 ist nur ein Teil der gesamten deduktiven Forschung)
Manipulation der freiheitliche demokratischen Grundordnung, des Grundgesetzes
Folgende Punkte sind eingestellt: 1. Artikel 93 Abs. 1 Nr. 4a und 94 Abs. 2 Satz 2 GG 2. Artikel 19 Absatz 4 GG, 3. Artikel 3 Abs. 3 GG 4. Artikel 1 Absatz 3 GG 5. Artikel 28 Abs. 3 GG 6. Artikel 142 GG
Danach sind unter den Titeln 7. Menschenrechtskonvention 8. Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte vergleichende Betrachtungen des Grundgesetzes mit Internationalem Recht eingestellt. 1. Artikel 93 Abs. 1 Nr. 4a und 94 Abs. 2 Satz 2 GG
a) die Einstellung des Beschwerderechts Artikel 93 Abs. 1 Nr. 4a GG
Zu Beginn der Existenz der Bundesrepublik Deutschland mussten die Bürger bei Verletzungen von Grund- und staatsbürgerlichen Rechten durch die Gerichtsinstanzen tingeln. Das unmittelbare Zugangsrecht zum Bundesverfassungsgericht war nicht gegeben. Dieses wurde erst am 29.01.1969 mit der Einstellung der Nr. 4 a in Artikel 93 Abs. 1 GG eingeführt: “Das Bundesverfassungsgericht entscheidet: ... 4a. über Verfassungsbeschwerden die von jedermann mit der Behauptung erhoben werden können, durch die öffentliche Gewalt in einem seiner Grundrechte oder in einem seiner in Artikel 20 Abs. 4, 33, 38, 101, 103, und 104 enthaltenen Rechte verletzt zu sein.”
b) die Aushöhlung des Beschwerderechts Artikel 93 Abs. 1 Nr. 4a GG durch Artikel 94 Abs. 2 Satz 2 GG
Vom Bürger offenbar vollkommen unbemerkt wurde zeitgleich mit der Einführung der Nr. 4a des Artikel 93 Abs. 1 GG das neu zugewiesene, unmittelbare Beschwerderecht beim Bundesverfassungsgericht aber auch schon wieder ausgehebelt. Dies wurde folgendermaßen umgesetzt. In Artikel 94 Absatz 1 ist die Zusammensetzung des Bundesverfassungsgerichts geregelt, die weiteren Regelungen wurden einem Gesetz zugewiesen, welches als Bundesverfassungsgerichtsgesetz installiert ist. Bezogen auf dieses Gesetz wurde Artikel 94 Abs. 2 ein zweiter Satz angehängt, dieser bestimmt: “Es (Anm.: das Bundesverfassungsgerichtsgesetz) kann für Verfassungsbeschwerden die vorherige Erschöpfung des Rechtsweges zur Voraussetzung machen und ein besonderes Annahmeverfahren vorsehen.” Durch diesen Satz wurde das den Bürgern über Artikel 93 Abs. 1 Nr. 4a GG zugewiesene unmittelbare Beschwerderecht klammheimlich unter den einschränkenden Vorbehalt gestellt, dass im Bundesverfassungsgerichtsgesetz BVerfGG nicht etwa die “vorherige Erschöpfung des Rechtsweges” oder “ein besonderes Annahmeverfahren” eingestellt ist. Die Folge: Ist im Bundesverfassungsgerichtsgesetz als einem dem Grundgesetz nachrangig gültigen Gesetz die Annahme einer Verfassungsbeschwerde zum Beispiel von der vorherigen Begehung des Instanzenweges abhängig gemacht, dann dominiert diese Bestimmung - anscheinend ganz legal - zum Beispiel Artikel 93 Abs. 1 Nr. 4a GG, obwohl der Artikel textlich nicht verändert wurde.
c) die Aushebelung der im Grundgesetz verankerten Grund- und staatsbürgerlichen Rechte des Bürgers durch das Bundesverfassungsgerichtsgesetz BVerfGG
Die Chancen, die sich die Parteien mit der Übertragung des Rechts auf Einschränkung des Beschwerderechts und der Annahme von Beschwerden auf das Bundesverfassungsgerichtsgesetz hinsichtlich der Sicherung des vereinnahmten Machtvolumens erarbeitet hatten, wurden rigoros ausgenutzt. Besonders zu erwähnen sind die Paragraphen 90 Abs. 2, 93 Abs. 3, 93 a Abs. 2 Nr. a und 93 d Abs. 1 BVerfGG, die von den Parteien kraft ihrer Beherrschung des Gesetzgebers im Bundesverfassungsgerichtsgesetz als das Grundgesetz dominierendes Recht eingestellt wurden (Anmerkung: erarbeitet vom Nazirichter „Willi Geiger“ auch als Schlächter von Bamberg bekannt) Ausführungen zu diesen Bestimmungen sind unter BVerfGG nachzulesen.
Alle vorgenannten Paragraphen haben eines gemeinsam: Sie wurden nicht auf der Grundlage des Artikel 79 Abs. 1 GG zu geltendem Recht erhoben, sind also nicht befähigt, Artikel des Grundgesetzes tatsächlich zu dominieren. Absatz 1 des Artikels 79 bestimmt nämlich: “Das Grundgesetz kann nur durch Gesetz geändert werden, das den Wortlaut des Grundgesetzes ausdrücklich ändert oder ergänzt.” Einzig legal wäre so gewesen, wenn die nach Meinung von Parteigängern zu Gunsten ihrer Parteien zu ändernden Artikel des Grundgesetzes in einem entsprechenden Gesetz geändert worden wären - mit der Folge der realen textlichen Änderung der zur inhaltlichen Änderung vorgesehenen Bestimmung.
Zur Umsetzung des Vorhabens, durch das Bundesverfassungsgerichtsgesetz die Aushöhlung entscheidender Artikel des Grundgesetzes zu bewerkstelligen, wurden Komplizen benötigt: Das Bundesverfassungsgericht musste dazu bewegt werden, die grundgesetzwidrigen Bestimmungen des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes bei Bedarf zur Grundlage der Rechtsprechung zu machen. Die Folge des heute gegebenen “erfolgreichen” Zusammenschlusses von Gesetzgeber (sprich der gesetzgebenden Parteien) und der Justiz zu einer Art Organisierter Kriminalität zum Nachteil der Bürger war und ist, dass den Richtern am Bundesverfassungsgericht seither zwei Varianten der Rechtsprechung zur Verfügung stehen, deren sie sich nach freiem Belieben bedienen können und auch bedienen:
1. Der qualifizierten Rechtsprechung auf der Grundlage des Grundgesetzes.
2. Der “politischen” Rechtsprechung auf der Grundlage des BVerfGG, von Verfassungsbeschwerden
Welche Variante das Gericht zum Einsatz bringt, wird fallbezogen entschieden. So wurde die Beschwerde, ob auch Apotheken an verkaufsoffenen Sonntagen geöffnet haben dürfen, per qualifizierter Rechtsprechung entschieden.
Dagegen wurden Verfassungsbeschwerden gegen das Bundeswahlrecht, durch welche die Macht der Parteien angegriffen wurde, per politischer Rechtsprechung entschieden - durch deren willkürliche Abweisung. Also gilt: Die Richter am Bundesverfassungsgericht dominieren auf der Grundlage des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes per Richterrecht das Grundgesetz - manchmal auch nicht. 2. Artikel 19 Absatz 4 GG Im Artikel ist die Rechtswegegarantie festgeschrieben, d. h., dass jedermann, der in einem Rechte verletzt wird, dieses auf dem Rechtsweg monieren können muss. Die Bestimmung lautet: “Ist jemand durch die öffentliche Gewalt in seinen Rechten verletzt, so steht ihm der Rechtsweg offen. Soweit eine andere Zuständigkeit nicht gegeben ist, ist der ordentliche Rechtsweg gegeben.” Der Rechtsweg nach Art. 19 Abs. 4 GG besteht, wie aufgezeigt, seit 1969 auf der Grundlage des Artikel 93 Abs. 1 Nr. 4 a GG unmittelbar zum Bundesverfassungsgericht.
In seiner Aussage konträr dazu steht § 93 Abs. 3 BVerfGG. Er bestimmt: “Richtet sich die Verfassungsbeschwerde gegen ein Gesetz oder gegen einen sonstigen Hoheitsakt, gegen den ein Rechtsweg nicht offensteht, so kann die Verfassungsbeschwerde nur binnen eines Jahres seit dem Inkrafttreten des Gesetzes oder dem Erlaß des Hoheitsaktes erhoben werden.” (Anm.: Dieser Satz wird in späteren Teilen noch von existenzieller Bedeutung. Der Leser ist gut beraten, sich diesen Satz und sein Entstehungszeitraum genauestens aufzuschreiben oder zu merken)
Festzustellen ist, dass die Bestimmung schon in sich selber nicht schlüssig ist. Entweder gibt es einen Rechtsweg, oder es gibt eben keinen Rechtsweg. Dass aber der Rechtsweg gegen ein Gesetz, gegen das es keinen Rechtsweg gibt, für die Dauer eines Jahres eben doch existent ist, entbehrt jeglicher Logik. Rechtsweg hin, Rechtsweg her, Fakt ist, dass in keinem Gesetz durch den Gesetzgeber unmittelbar bestimmt ist, dass der Rechtsweg dagegen nicht gegeben ist. So gilt, dass gegen jedes Gesetz oder sonstigen Hoheitsakt, durch das/den ein Grund- oder staatsbürgerliches Recht des Bürgers eingeschränkt wird, auf der Grundlage des Artikel 19 Abs. 4 GG in Verbindung mit Artikel 93 Abs. 1 Nr. 4 a GG auch der unmittelbare Rechtsweg zum Bundesverfassungsgericht gegeben ist.
Bezogen auf Verfassungsbeschwerden, im Rahmen derer vom Bundesverfassungsgericht in Sachen § 93 Abs. 3 BVerfGG zu entscheiden ist, ob gegen ein Gesetz vom Gesetzgeber der Rechtsweg unmittelbar ausgeschlossen ist, die Frage: a) Wer, bitte, und auf welcher Rechtsgrundlage, bestimmt eigentlich im Zuge einer Verfassungsbeschwerde, dass gegen ein Grund- und/oder staatsbürgerliche Rechte verletzendes Gesetz der Rechtsweg nicht offen steht, wenn der Gesetzgeber diesen nicht unmittelbar ausgeschlossenen hat? b) Wenn ein Bürger nun erst nach Ablauf der Frist von einem Jahr nach § 93 Abs. 3 BVerfGG erkennt, dass durch ein bestimmtes Gesetz ein Grundrecht, zum Beispiel das Diskriminierungsverbot nach Artikel 3 Abs. 3 GG verletzt ist, dominiert dann das Grundrecht die ausgeschlossene Rechtswegegarantie und die festgelegte Verjährungsfrist? Oder doch nicht?
Richtige Antworten: Zu a) Das Bundesverfassungsgericht bestimmt trotz fehlender Vorgabe durch den Gesetzgeber und konträr zu Artikel 19 Abs. 4 GG vollkommen selbstherrlich, also rein willkürlich, ob gegen ein Gesetz der Rechtsweg gegeben ist oder nicht.
Zu b) Bestimmt das Bundesverfassungsgericht, dass gegen ein Gesetz kein Rechtsweg gegeben ist und hat der in einem Rechte verletzte Bürger die vom Gericht als existent unterstellte Jahresfrist versäumt, kann er sich sein verletztes Recht “irgendwohin stecken”, es bleibt verletzt.
Unabhängig von der Bestimmung § 93 Abs. 3 BVerfGG hat der Gesetzgeber den Verfassungsrichtern noch eine andere Bestimmung an die Hand gegeben, mittels der diese den Bürger grundrechtswidrig vom Rechtsweg abschneiden können: Paragraph 93 a BVerfGG. Er gibt vor, dass Verfassungsbeschwerden angenommen werden müssen. Also ist im Umkehrschluss die Nichtannahme einer Verfassungsbeschwerde auf der Grundlage der vorgenannten Bestimmung nichts anderes als die willkürliche Unterdrückung der Rechtswegegarantie nach Artikel 19 Abs. 4 GG durch die vorgenannte Bestimmung des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes. (Hierzu verweise ich auf Teil 1 in #mein-fall, § 93 a BVerfGG). Dass das Bundesverfassungsgericht jedoch beide Varianten der Unterdrückung des Rechtsweges als Mittel zur Abweisung von Verfassungsbeschwerden hemmungslos zur Anwendung bringt, wird unter wird mit der in Teil 1 aufgezeigten Verfassungsbeschwerde belegt. 3. Artikel 3 Abs. 3 GG Der Artikel legt das Diskriminierungsverbot fest. So ist mit Artikel 3 Abs. 3 GG unvereinbar, dass mittels des Wahlrechtes den Parteien das exklusive Recht zur Einreichung der so genannten Landeslisten eingeräumt ist, der übliche Bürger aber keinen Zugang zu den Listen der Parteien hat. Das heißt, der Bürger ist nicht in der Lage, sich auch nur um ein einziges per Liste zu vergebendes Mandat zu bewerben. Wer aber nun meint, das sei nicht so schlimm, es sei ja nur die Hälfte aller Mandate, der irrt. Nach dem Bundeswahlgesetz werden von den Parteien per Listenwahl alle Mandate, und zwar alle 598 Mandate besetzt. Erst nachfolgend werden auf diese Listenmandate die Direktmandate angerechnet. Damit ist der Fakt gegeben, dass die Parteien nicht abwählbar sind, wie in Teil 2 „Wahlanfechtung“ der Bundestagswahl vom 22.09.2002 umfassend belegt wird.
Gleiches gilt auch in den Bundesländern. Verfassungsbeschwerden gegen die installierte Diskriminierung werden vom Bundesverfassungsgericht durch die vor aufgezeigten Bestimmungen §§ 93 Abs. 3 und 93 a BVerfGG abgewürgt. Das heißt, dass auch hier Bestimmungen des dem Grundgesetz nachrangig gestellten Bundesverfassungsgerichtsgesetzes das Grundgesetz dominieren - dank Richterrecht. Anscheinend ganz legal - und der Bürger bleibt in seinen Rechten verletzt. 4. Artikel 1 Absatz 3 GG lautet, “Die nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und Rechtsprechung als unmittelbar geltendes Recht.” In dieser Bestimmung ist die Basis gelegt, dass Verfassungsrichter, mindestens die am Bundesverfassungsgericht tätigen, überhaupt der ihnen übertragenen Aufgabe als Hüter der Verfassung entsprechen können. Sie ist im Grundsatz die Arbeitsanweisung, zu überwachen, dass nicht nur die Gesetzgebung, sondern in besonderem Maße auch die Rechtsprechung in allen Bereichen des Rechts, so im Zivilrecht genauso wie im Strafrecht oder im Verwaltungsrecht, grundsätzlich keines der in den Artikeln 1 bis 19 enthaltenen Grundrecht der Bürger verletzen darf. Eine grundrechtswidrige Gesetzgebung ist genauso nichtig zu stellen.
Auch der Amtseid der Richter nach § 11 Abs. 1 BVerfGG zwingt diese zur grundsätzlichen Beachtung des Grundgesetzes: “Ich schwöre, daß ich als gerechter Richter alle Zeit das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland getreulich wahren und meine richterlichen Pflichten gegenüber jedermann gewissenhaft erfüllen werde.”
Während die qualifizierte Rechtsprechung diesen Vorgaben umfassend entspricht, wird per politischer Rechtsprechung deren Umgehung praktiziert. - Die Rechtsprechung dominiert das Grundgesetz? Aber bitte doch! - Der Amtseid? Was soll’s! - Die Grundrechte sollen unantastbar sein? Nicht mit uns! - Rechtswegegarantie? Nie gehört!
Dass die Verfassungsrichter in einem ganz präzise zu benennenden Bereich exakt diese Art der Rechtsprechung praktizieren, nämlich die gesamten Grund- und staatsbürgerlichen Rechte der Bürger nichtig stellen, kann belegt werden: Es ist der Fall bei Verfassungsbeschwerden, die geeignet sind, das von den Parteien besetzte Machtvolumen zu reduzieren. Hierzu gehören Verfassungsbeschwerden in Sachen Bundeswahlgesetz. Der Beleg idazu habe ich in Teil 1+2 #mein-fall zum Bundeswahlrecht aufgezeigt.
• 5. Artikel 28 Abs. 3 GG Der Bund gewährleistet über diesen Artikel die verfassungsmäßige Ordnung in den Ländern. Er garantiert, “daß die verfassungsmäßige Ordnung der Länder den Grundrechten und den Bestimmungen der Absätze 1 und 2 entspricht.” Im Artikel unter anderem enthalten ist die Zusicherung der unmittelbaren und freien Wahl, gegen die in Bundeswahlen und Landeswahlen besonders in Baden-Württemberg eklatant verstoßen wird, wie damals schon festgestellt, und in anderen Bundesländer in nichts nachsteht.
Eine einseitige Erklärung wie die in Artikel 28 Abs. 3 GG bewirkt auf der Gegenseite immer ein Recht, in diesem Fall das Recht der Bürger, die zugesagte “verfassungsmäßige Ordnung” dann einzufordern, wenn diese in einem Bundesland nicht oder nur bedingt gegeben ist. Auf ein Ersuchen an Herrn Bundeskanzler Schröder ließ dieser durch das Bundesinnenministerium erwidern:
“auf Ihr Schreiben an den Herrn Bundeskanzler, das mir vom Bundeskanzleramt zugeleitet wurde, teile ich Ihnen mit, dass das Wahlrecht des Landes Baden-Württemberg nach Ansicht der Bundesregierung nicht gegen Artikel 28 Abs. 1 GG verstößt. Daher vermag ich mich für Ihr Anliegen nicht zu verwenden.” gez. Miklikowski (Az. V 1b - 110 010 II).
Bleibt die Frage: Und was, bitte, ist die Garantie aus Artikel 28 Abs. 3 GG wert, wenn diese weder per Verfassungsbeschwerde noch im Rahmen eines Zivilrechtsprozesses eingefordert, und vom Bundeskanzler als Garanten per veranlasster Erklärung einfach so nichtig gestellt werden kann, weil Richter die Beschwerden auf der Grundlage von dem Grundgesetz nachrangig installierten Gesetzen platt machen? Richtig, absolut nichts! Damit ist die ganze Bestimmung es nicht wert, abgedruckt zu werden. Im Grundgesetz. Was in Baden-Württemberg neben dem Wahlrecht weiter nicht stimmt, wird gleich in Kurzform aufgezeigt. 6. Artikel 142 GG In Artikel 142 GG, Grundrechte in Landesverfassungen, ist bestimmt: “Ungeachtet der Vorschrift des Artikels 31 (Anm.: Bundesrecht bricht Landesrecht) bleiben Bestimmungen der Landesverfassungen auch insoweit in Kraft, als sie in Übereinstimmung mit den Artikeln 1 bis 18 dieses Grundgesetzes Grundrechte gewährleisten.”
Der den Grundrechten angehörige Artikel 19 ist hier ausgegrenzt. Das heißt, dass gemäß Artikel 142 GG die in Artikel 19 enthaltene Rechtswegegarantie (Abs. 4) und auch die weiter enthaltene Unantastbarkeit der Grundrechte (Abs. 2) in den Ländern gelten können, aber nicht gelten müssen. In Baden-Württemberg gelten sie nicht. So ist per Landesverfassung Art. 68 Abs. 1 Nr. 2 bestimmt, dass der Staatsgerichtshof “bei Zweifeln oder Meinungsverschiedenheiten über die Vereinbarkeit von Landesrecht mit dieser Verfassung” zu entscheiden hat. In Absatz 2 Nr. 2 des Artikels ist jedoch weiter bestimmt: Antragsberechtigt ist im Fall “des Absatz 1 Nr. 2 ein Viertel der Mitglieder des Landtags oder die Regierung.” Und damit sind nur noch die zur Beschwerde berechtigt, welche Installation und Inhalt der Gesetze zu vertreten haben, durch die Grundrechte verletzt werden, die Landesregierung und der Landtag. Der betroffene Bürger nicht.
Der Staatsgerichtshof für das Land Baden-Württemberg wurde im Zuge von Verfassungsbeschwerden darauf hingewiesen, dass die praktizierte Rechtsprechung nicht mit Artikel 2 der Landesverfassung zu vereinbaren ist, denn dort ist bestimmt: “Die im Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland festgelegten Grundrechte und staatsbürgerlichen Rechte sind Bestandteil dieser Verfassung und unmittelbares Recht.” Und damit hat über diese Bestimmung auch in Baden-Württemberg die Rechtswegegarantie und die Unantastbarkeit der Grundrechte Bestand, denn zu den Grundrechten gehört auch Artikel 19 GG, und zwar umfassend!
Ungeachtet dessen, dass die Landesverfassung wirklich nicht nur aus Artikel 68 besteht, wurden die Beschwerden wegen nicht gegebener Berechtigung d