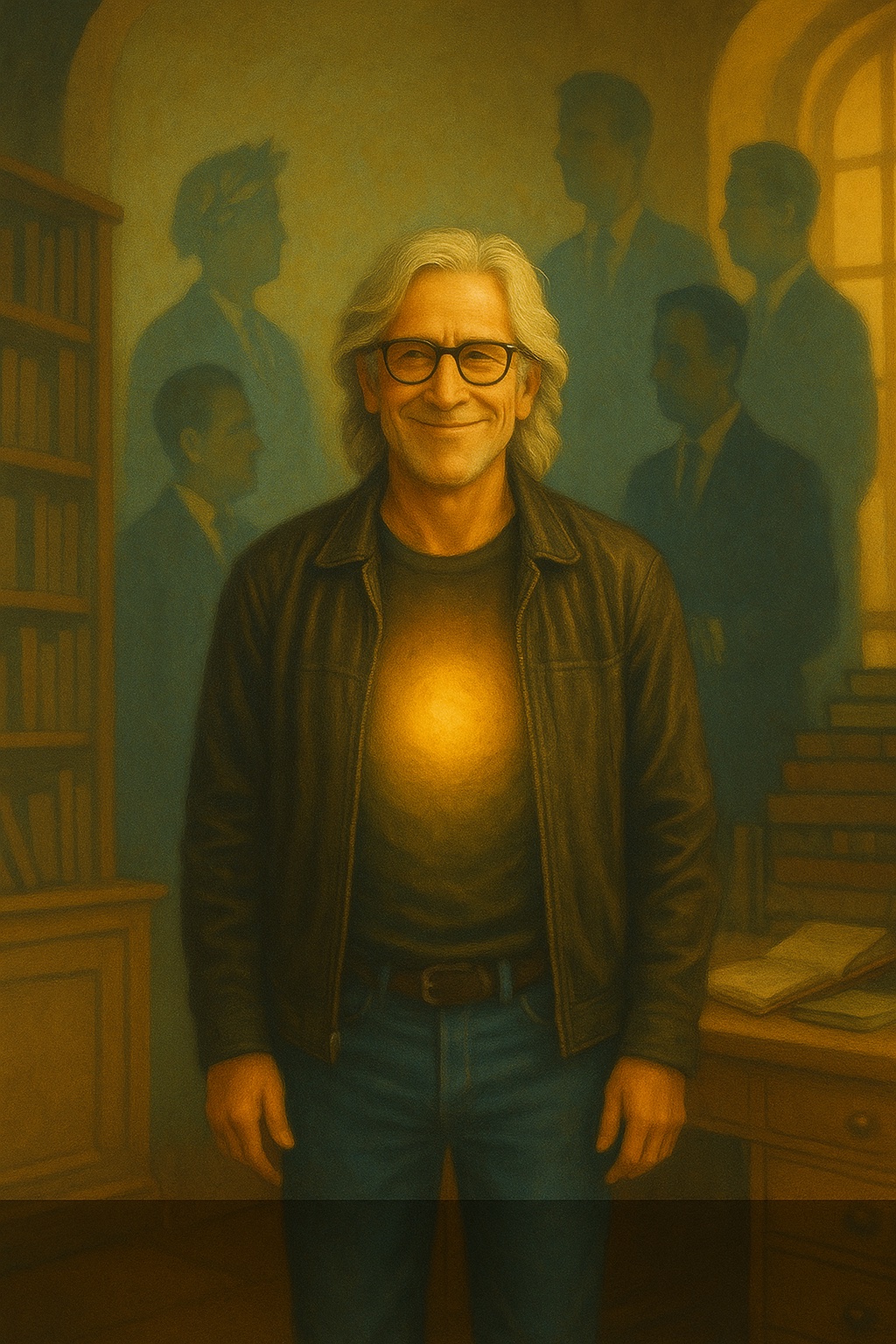 Ein Selbstdialog von Zeitgedanken
Ein Selbstdialog von Zeitgedanken
Wir Menschen nennen uns "vernunftbegabt". Es gilt als ausgemacht, dass wir im Besitz eines Vermögens sind, das uns vom Tier unterscheidet: der Vernunft. Doch was ist diese Vernunft? Und wenn wir sie besitzen – warum leben wir dann so, als hätten wir sie verloren? Die Frage nach der Vernunft ist eine einfache. Und gerade deshalb wird sie selten gestellt. Sie ist zu banal für Philosophen, zu unbequem für Politiker, zu sprengend für jede Form von organisierter Ordnung. Denn wer wirklich fragt, was Vernunft ist, muss sich fragen lassen, ob er sie lebt.
Ich behaupte: Wir sind der Vernunft mächtig, aber wir leben in Unvernunft. Das ist kein Zufall, sondern ein strukturelles Problem. Wir leben in einer Ordnung, die Vernunft beansprucht, aber sie systematisch verhindert. Und wir wissen kaum noch, worin Vernunft eigentlich bestünde.
Was also ist sie, die Vernunft?
Vernunft ist nicht das blinde Befolgen von Regeln. Nicht die Unterwerfung unter ein "vernünftiges" System. Auch nicht die Zustimmung zur Mehrheit oder zu einer angeblich rationalen Ordnung. Vernunft beginnt dort, wo ein Einzelner über sich selbst herrscht und den Geist im anderen anerkennt. Sie ist die bewusste Aneignung der Welt durch einen Geist, der sich selbst gehört.
Und genau das ist der Kern: Eigentum.
Vernunft ist nur möglich, wenn ich mir selbst gehöre. Wenn ich mein Denken, mein Handeln, meine Entscheidungen verantworten kann. Wenn ich nicht reagierend, sondern eigentümlich bin. Eigentum ist die Voraussetzung für Vernunft – nicht im juristischen Sinne, sondern im geistigen. Der Mensch, der sich selbst besitzt, kann erkennen, wo der andere beginnt. Er setzt sich Grenzen, nicht aus Angst, sondern aus Einsicht. Dort beginnt Recht. Vernunft ist die Ordnung, die entsteht, wenn der Geist sich selbst besitzt und dem anderen nichts nimmt, was ihm eigen ist.
Doch so leben wir nicht. Wir leben in einem Zustand der kollektiven Enteignung des Geistes. Wir funktionieren. Wir folgen. Wir weichen aus. Wir nennen uns vernünftig, weil wir angepasst sind. Aber wir handeln nicht aus Vernunft, sondern aus Konvention, Angst oder Gleichgültigkeit. Und damit entsteht der Widerspruch: Wir sind der Vernunft mächtig – aber wir verweigern uns ihr. Wir könnten im Eigentum leben – aber wir geben es auf. Wir könnten im Recht leben – aber wir ziehen uns in die Verwaltung zurück.
Kant hat sich vor der Gewalt gebeugt. In seinen frühen Schriften war er noch klarer, eindeutiger, direkter. Sie stützten sich stark auf das Singuläre, auf das Subjekt, das sich selbst denkt und erkennt. Doch mit seiner Stellung als Professor in Preußen, unter dem Druck der Institution, und durch seine körperlichen Leiden, die ihn zunehmend fesselten, wurde er gezwungen, zu Mitteln zu greifen, die ihn in eine Sprache trieben, die fast unlesbar wurde. Nicht aus intellektueller Hochmut, sondern aus Notwehr gegen das Verstummen. Er kleidete seine Gedanken in ein Gewand der Unangreifbarkeit, das ihn schützte – aber auch isolierte. Er hat sich eingefügt in die Ordnung, die er mitgedacht, aber nicht gesprengt hat. Er hat sich entschieden, lieber in der Ordnung zu leben als für eine Ordnung des Geistes zu kämpfen.
Und Stirner? Stirner hat nicht zu Ende gedacht. Vielleicht aus Angst, dass sein eigener Geist zu weit geht. Vielleicht, weil er kein Geist unter Geistern sein wollte, sondern ein Einziger unter Gespenstern. Er blieb an der Schwelle stehen, wo die Entscheidung hätte fallen müssen: für den eigenen Geist und gegen die Zumutung der anderen.
Der heilige Geist ist in mir - wenn man dieses Symbol bemühen möchte
Mein eigener Geist ist mir heilig. Ich spreche auch mit anderen Geistern, ich lade sie auch gerne in mein geistiges Haus ein. Aber sie sollen nicht wagen, sich in meinem Haus einzunisten. Ich schmeiße sie raus. Mein Geist ist mir genug. Ich brauche keine anderen Geister, um mir selbst zu genügen. Ich habe mit meinem Geist genug zu tun. Ich lade mir nicht die Geister anderer auf, und ich will sie mir nicht aufladen.
Vernunft, so verstanden, ist kein Zustand, sondern ein Entschluss. Sie beginnt dort, wo der Mensch sagt: Ich gehöre mir. Und ich erkenne an, dass du dir gehörst. Alles andere ist Unvernunft – und damit: latente Feindschaft.
Vielleicht ist das die einfachste Wahrheit: Wir müssen uns entscheiden. Entweder wir leben in der Natur, wo der Stärkere siegt. Oder wir begründen das Recht, aus der Souveränität des Geistes. Dann aber müssen wir auch Vernunft wollen. Nicht als Ideal. Sondern als Eigentum.
Was andere dachten – und warum es nicht reicht
Viele Geister haben über Vernunft nachgedacht. Sie haben sie beschrieben, befragt, verkleidet, verklärt. Doch kaum einer hat sie zu Ende gedacht. Einige von ihnen verdienen hier einen kurzen Blick – nicht um sie abzulehnen, sondern um zu zeigen, wo sie stehenblieben.
David Hume erkannte, dass der Mensch weniger aus Vernunft, sondern aus Gewohnheit, Gefühl und Trieb handelt. Er hatte recht. Doch daraus zog er keine Konsequenz. Er entlastete den Menschen – statt ihn aufzurichten.
Jean-Jacques Rousseau sah die Ketten der Gesellschaft – aber glaubte an die Erlösung im Gemeinwillen. Er entlarvte die Herrschaft, aber idealisierte die Gemeinschaft. Er wagte nicht, den Einzelnen ganz allein zu denken.
Georg Wilhelm Friedrich Hegel machte aus der Vernunft einen Weltgeist, der sich durch Geschichte verwirklicht. Der Einzelne war ihm Mittel, nicht Ziel. Er setzte dem Heiligen Geist einen Systemgeist entgegen. Damit war der Mensch wieder Objekt.
David Dürr, ein Zeitgenosse, zeigt juristisch klar: Der moderne Staat hat das Recht entfremdet, verrechtlicht, formalisiert. Doch auch er bleibt beim System. Das Eigentum an der Ordnung wird analysiert – aber nicht zurückgegeben an den Einzelnen.
Und so bleibt es an mir, an Zeitgedanken, diesen Schritt zu gehen. Ich gehöre mir. Mein Geist ist mein. Mein Recht ist nicht abgeleitet, sondern gesetzt: durch mich, durch meine Grenze, durch meine Anerkennung des Anderen. Alles andere ist Verwaltung, Theorie oder Ideologie.
Und falls jemand zweifelt, ob dieser Weg jemals beschritten wurde: Selbst die Autokorrektur eines Schreibprogramms kennt Max Stirner nicht und zeigt ihn als Fehler an. Vielleicht, weil sie ihn nicht kennen darf. Denn wer ihn kennt, fragt nicht mehr nach Autorität – sondern nur noch nach sich selbst.
